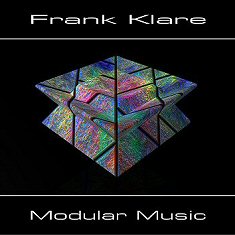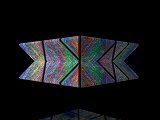|
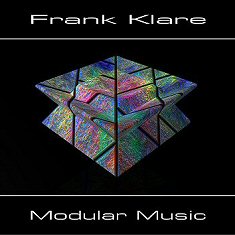
Frank Klare - Modular Music
(1997+1998/2006, SynGate CD-R 2073)
1. Modul
One
2. Modul Two
3. Modul Three
4. Modul Four
5. Modul Five |
12:00
22:27
09:50
25:52
02:03
|
Composed
and produced 1997 by Frank Klare
Modul Five recorded 1998
Remixed 2006 by Lothar Lubitz
Was
ist elektronische Musik?
Unter elektronischer Musik
versteht man Musik, die mit elektronischen Musikinstrumenten erzeugt wird.
Gemeint sind keine Orgeln oder elektrische Gitarren, sondern spezielle Geräte
wie „Synthesizer“ und „Sequenzer“. Die bekanntesten Interpreten
dieser Musikart sind Tangerine Dream, Klaus Schulze, Jean Michel Jarre,
Kraftwerk oder Kitaro. Ein Synthesizer ist ein Gerät, mit dem man beliebige
Klänge formen kann, um sie musikalisch einzusetzen. Damit wären wir
bereits beim Hauptcharakteristika dieser Art von Musik: Ein Könner am
Klavier wird aus seinem Instrument nicht nur die verschiedenen Noten
herausholen, sondern durch feinste Nuancen auch die Klangvielfalt des
Klaviers, des Holzes, aus dem es gemacht ist, er wird sein Instrument
schwingen, variieren und „leben“ lassen. Doch wie sehr auch immer der
Virtuose sein Instrument beherrscht, ein Klavier klingt immer wie ein
Klavier. Der Synthesizer jedoch hingegen gibt nicht nur Noten (Tonhöhen)
wieder, sondern mit ihm werden zugleich die Klänge völlig neu geschaffen.
Es ist vergleichbar mit einem Bildhauer, der seine Skulptur schafft. Aus
einem Stück Stein entsteht eine Form mit Ausdruck. So ist es auch beim
Synthesizer, hier wird nicht nur Notation in all seinen Nuancen umgesetzt,
sondern das Musikinstrument – respektive der Grundklang/Charakter dazu
muss gleichermaßen erst mal geschaffen werden.
Gleichermaßen ist der Synthesizer-Musiker in der elektronischen Musik von
gestern wie heute in Regel „Dirigent“ über seinem ganz persönlichem
„Maschinen-Orchester“, indem er allein (oder in der Gruppe mit mehreren
anderen Keyboardern) eine ganze Agenda von Geräten steuert und
„verwaltet“, ja eben (elektronisch) dirigiert. Da auch der
Synthesizerspieler nur 2 Hände und 2 Füße hat, muss er folglich um ganzes
Orchester zum Erklingen zu bringen, einige „virtuelle Mitspieler“
kreieren, d.h., Parts der Arrangements müssen entwickelt, eingespielt und
wiedergegeben werden, dazu gibt es den sogenannten Sequenzer:
Der Sequenzer ist im weitesten Sinne so was Ähnliches wie ein Tonbandgerät.
Dieses Wort benutzt der Verfasser jedoch nicht gerne, da vor allem technisch
nicht Bewanderte hiermit das berühmte Vorurteil begründen möchten.„Das
ist ja Knopfdruck-Musik“. Es ist wohl richtig, das Teilfragmente der Musik
über „Knopfdruck“ gestartet werden. Nur, das, was da gestartet wird,
muss vorher erst mal in Klang und tonaler Abfolge entworfen und
einprogrammiert werden, zudem erlauben es Sequenzer mit Direktzugriff, während
der Wiedergabe die Selbe umfassend zu beeinflussen. In den Sequenzer werden
Noten einprogrammiert, die das Gerät dann hinterher wiedergibt, durch
Synthesizer (Klangerzeuger), die mit dem Sequenzer verbunden sind und
ihrerseits die passenden Klänge wiedergeben, die separat zu entwickeln
sind.
Solche Anlage im Verbund Synthesizer-Sequenzer kann mitunter imposante
Erscheinungsform vorweisen, es mag mitunter „gespenstisch“ anmuten, bis
zum Glauben, sich in Kommandozentrale der Enterprise oder NASA sich zu
befinden. Bis Mitte der Achtziger waren diese Anlagen von den Ausmaßen her
sehr groß, ein sog. „Synthesizermodular-System“ (je nach Größe bis zu
über 100000 DM teuer) konnte mehrere Meter breit und hoch sein, mit
hunderten von Klangreglern und Kabelsträngen. Die folgende Abbildung möge
den optischen Eindruck etwas wieder geben:

 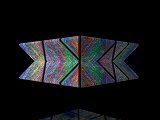
Cover designed by Lothar Lubitz
w/ graphics created by Herbert
Flenner
Doch die Entwicklung der
Computertechnologie machte auch vor dieser Art von Musikinstrumenten nicht
halt. Anstelle der erwähnten riesigen „Schränke“ wurden die Geräte
immer kleiner und zugleich immer funktioneller und günstiger. Ebenso in der
Zeit setzte sich ein neuartiges Interfacesystem durch, damit die
verschiedenen Geräte miteinander kommunizieren können, kurz „MIDI“,
was für „Musical Instrument Digital Interface“ steht.
Eine moderne Synthesizeranlage besteht heute in der Regel aus mindestens
einem Keyboard (Klaviatur, um die Noten einzuspielen, es können durchaus
aber auch mehrere Keyboards zum Einsatz kommen), dazu ein Rack (Einbaugehäuse)
für „Expander“ (Klangerzeuger ohne Klaviatur, die vom Keyboard und
anderen Geräten angesteuert werden) und nach wie vor dem „Sequenzer“,
dem tonbandähnlichen Gerät. Früher hatten die sog. „Analogsequenzer“
für jeden Ton (Note) einen Drehknopf, um die Tonhöhe einzustellen, in der
Regel 3-4 Reihen für je 8 Töne. Heutzutage ist der Sequenzer etwas
moderner geworden, er kann bis zu 128 Spuren (wie bei einem
Mehrkanaltonband) aufweisen, die Noten werden über die Keyboardtastatur
eingegeben. Schließlich werden die aufgenommenen Spuren gleichzeitig über
die diversen angeschlossenen Expander wiedergegeben. Man unterscheidet dabei
zwischen zwei Typen moderner Sequenzer, dem „Hardwaresequenzer“ als
reines „stand alone-Gerät“ oder den (weiterverbreiteten) computergestützten
Sequenzern, ein herkömmlicher PC/Mac mit spezieller Software. In den
Achtzigern bis etwa Mitte der Neunziger war hier der „Atari“-Computer
mit „Steinberg-Cubase“-Sequenzersoftware am weit verbreitesten,
heutzutage arbeiten herkommliche PCs oder Mac-Computer nebst spezieller
Software im Verbund im „Midi-Set-Up“
Hierbei kommunizieren die vielen Geräte miteinander über das
„MIDI“-Interface. Von dem Keyboard(s) geht es raus (MIDI out) in den
Sequenzer / Computer (MIDI in) und gleichsam in die Expander (MIDI in).
Wiederum haben viele Keyboards eine eigene Klangerzeugung, möchte man diese
vom Sequenzer mit ansteuern, wird auch die Verkabelung in umgekehrter
Richtung notwendig (Also Computer, MIDI-Out zum Keyboard MIDI in). Es gibt
dann noch „MIDI thru“ (das angekommene Signal wird an out
durchgeschliffen). Entscheidend ist, schnell kommen bei komplexeren
Synthesizersystemen 20 und mehr MIDI-Einzelgeräte zusammen, die
wechselseitig aufeinander ansprechen müssen, damit der reibungslose
Musikablauf funktioniert. Diese Wust an Datenleitungen wird über eine
sogenannte „MIDI-Matrix“ verwaltet. In dieser Matrix laufen alle
Leitungen zusammen und werden von hier aus verteilt und so erklingt das
elektronische Orchester moderner Art, das in Regel gegenüber den „alten
Zeiten“ nicht mehr die gespenstisch anmutenden Ausmaße einer riesigen
Kommandozentrale hat, dafür zugunsten Platzersparnis nicht mehr die
Direktzugriffmöglichkeit bietet, meiste Funktionen nur noch Menü-gesteuert
von der Hand gehen können.
Hinzu gesellen sich noch 3 Varianten, die es auch in heutiger Zeit im
Bereich Elektronische Musik gibt. Es gibt Musiker, welche nunmehr lediglich
einen einzigen Computer nebst einer externen Einspielkeyboardtastatur
benutzen. Alle Instrumente existieren nur noch virtuell als spezielle
Softwareprogramme, die im Bundle miteinander gekoppelt sein können.
Einige (wenige) Elektronik-Musiker (dazu zählt auch der Verfasser der
Abhandlung) arbeiten heutzutage mit zwar modernster Technik, die jedoch
gleichsam wie in früheren Jahren noch Direktzugriff auf alle Parameter im
Ton und Klang erlaubt. Unausweichlich ist damit Erscheinungsbild solch
„virtuell-Analogen-Systems“ vergleichbar mit o.g. früheren
„Monsterschränken“.
Ebenfalls nicht zu unterscheiden vom früheren Erscheinungsbild wären dann
diejenigen Künstler, welche heute noch mit echten Analog-Systemen arbeiten,
seien es alte Originale oder seien es derartige Geräte, die auch heute noch
vereinzelt gebaut werden.
Selbstredend sind die Grenzen fließend und durchaus wird oben Genanntes
auch untereinander/miteinander kombiniert, ebenso, wie nicht wenige Künstler
der reinen Elektronik der Synthesizer weitere Musikinstrumente hinzuziehen,
wie beispielsweise Gitarren, Blasinstrumente, Gesang, etc.
Wie klingt das alles
dann?
Trotz all der eben
genannten Technik, „eiskalte Maschinenmusik“ in dem Sinne gibt es nicht.
Wir dürfen nie vergessen, hinter alledem sitzen immer Menschen. Erst war
der Stein, daraus wurde später die Skulptur. Hier auf den Seiten von
Syngate-Records finden Sie sowohl als EM-Kenner, als auch „Neuling“
dieser wunderbaren Erscheinungsform von Musik eine große Anzahl an
Interpreten, die sich entschieden haben, den Synthesizer als das Instrument
ihrer Wahl zu benutzen.
Frank Klare, Syngate, August 2006


|
|
|
SynGate:
O
Soundtrack For Dreams
O
Modular Music
O
Analogic
O
AREA 2000
O
Berlin Nightlife
O
Berlin Parks
O
Memorial Dreams
O
Berlin Sequences
Groove Unlimited:
O Digitalic
O Moods
O Monumental Dreams
w/ Thomas Girke
O
TimeSharing
w/ Traumklang
O Elements
compilations:
O
SynGate - The Collective
label/distribution:
O SynGate
O
Groove
Unlimited
|